Israel Hartmann (1725 bis 1806) vor 300 Jahren geboren
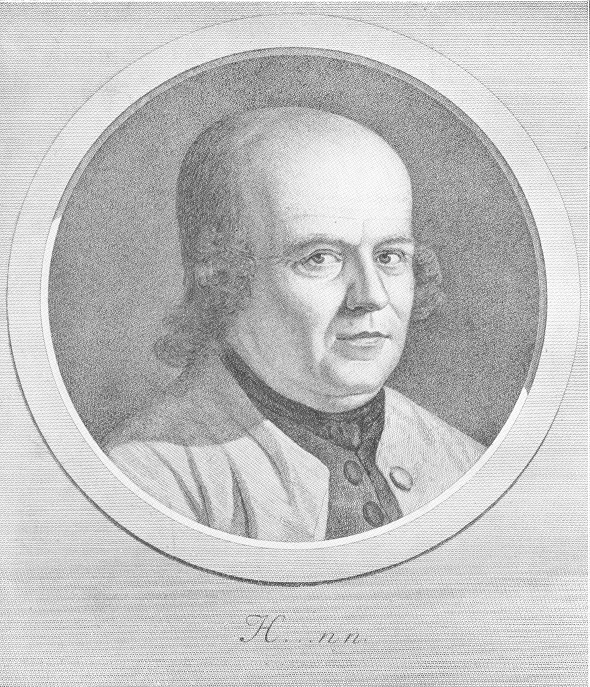
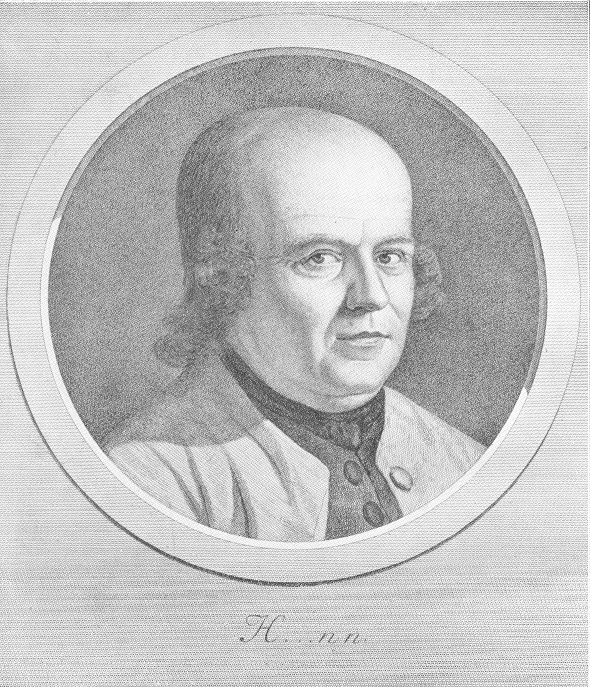
Israel Hartmann wurde am 26. Februar 1725 in Plieningen als jüngster Sohn von Michael Hartmann (1680 bis 1757), Gastgeber zum Ochsen, Metzger und Gerichtsverwandter, auch Bürgermeister und seiner ersten Frau Katharina geborene Fröschlin (1683 bis 1740) geboren. Seine Mutter, eine Tochter des Michael alt Fröschlin, Bürger in Plieningen und Anna geborene Vetter, wird im Hartmannbuch 1953 als „eine fleissige Hausmutter“ beschrieben „und hat ihre Kinder zu allem guthen angehalten“. Der kleine Israel hatte 14 Geschwister, wovon aber nur sechs heranwachsen durften, weil die anderen im frühen Kindesalter starben. Als Kind fühlte sich Israel sehr zur Mutter hingezogen, die durch ihre Frömmigkeit ein Vorbild für ihn war. Sein Vater wollte eigentlich, dass Israel das Metzgerhandwerk erlernen soll, daraus wurde aber nichts nach Israels Konfirmation. Sein 15 Jahre älterer Bruder Georg Hartmann (1710 bis 1796), erkannte die Begabung seines jüngsten Bruders und konnte den Vater überzeugen, Israel nach dem Schulabgang weiterhin im Schreiben, Rechnen und dem Klavierspiel durch den Plieninger Schulmeister unterrichten zu lassen. Außerdem erhielt Israel durch den pietistisch geprägten Vikar Johann Wilhelm Moser (1710 bis 1759) Einblick in die lateinische Sprache. Damals war Joachim Ludwig Dannenberger (1670 bis 1743) Pfarrer in Plieningen, der sich sehr um die Familie Hartmann angenommen hatte. Vikar Moser war ein Bruder des berühmten Rechtsgelehrten Johann Jacob Moser (1701 bis 1785), der vom Herzog auf der Festung Hohentwiel eingekerkert wurde.
Etwa 200 Plieninger Schulkinder durfte Israel Hartmann als Stellvertreter des Schulmeisters unterrichten. Dann führte ihn der Weg nach Uhlbach, wo er ebenfalls so ein Stellvertreter war. Mit 17 Jahren wurde Israel Hartmann als Provisor anerkannt und wird im Visitationsbericht vom 18. Mai 1744 als „vom Dekan examiniert, Alter 19 Jahre“ beschrieben. Darin wird Israel auch als frommer, stiller, bescheidener und fleißiger Mensch begutachtet. Schulunterricht fand damals fast nur in den Winter- und Frühjahrsmonaten statt, weil die Kinder in der Landwirtschaft mithelfen mussten. Daneben gab es auch die Sonntagsschule, für die der Pfarrer zuständig war, der auch die vierjährige Vorbereitung auf die Konfirmation leitete. Ein wichtiger Teil der damaligen Schulpädagogik war das Singen und das Auswendiglernen von Texten, so dass die Lehrer auch sehr musikalisch sein mussten. Israel konnte sich demnach später in Ludwigsburg auch als Hoforganist betätigen.
Durch den Tod der Mutter 1740 wurde Israel ein entschlossener Pietist, so dass das Pietisten-Reskript 1743 für ihn sehr wichtig war. Israel Hartmann übernahm den Provisorposten in Echterdingen von 1744 bis 1748. Danach erhielt er eine etwas besser dotierte Stelle als Amtsverweser in Oberriexingen bei Vaihingen/Enz bis 1750, wo er die Herrnhuter Schriften intensiv vermittelte. In diesem Jahr lernte er in der „Sommervakanz“ (in den Ferien) im damaligen Kloster Offenhausen/Alb, wo sein Bruder Georg als Stutenmeister tätig war, seine künftige Ehefrau Agnes Rosine Burk (1727 bis 1795) kennen. Ihr verstorbener Vater war Lehrer in Neuffen. Die Heirat war erst im November 1751 möglich, nachdem Israel eine ordentlich bezahlte Schulmeisterstelle in dem Weinbauort Roßwag übernehmen konnte. Durch diese Ehe wurde Israel Hartmann mit Johann Albrecht Bengel (1687 bis 1752) verwandt. Bengel war auch Prälat im Kloster Herbrechtingen. Dort kann man heute noch die „Bengel-Stube“besichtigen.
In Roßwag kamen drei Kinder des Ehepaares Israel Hartmann zur Welt. Deshalb bemühte er sich um eine noch besser dotierte Stelle, die er als Waisenhaus-Schulmeister 1755 in Ludwigsburg fand. Dort standen ihm meistens zwei Provisoren zur Seite. Nach einhelligen Urteilen der Kirchenbehörde war Israel Hartmann als tief religiöser Menschenfreund der bedeutendste Schulmeister, den diese Einrichtung jemals hatte.
In Ludwigsburg wurden dem Ehepaar Hartmann weitere Kinder geboren, von denen aber einige früh starben. Als Paten fungierte regelmäßig der „Waysen-Pfarrer“ Matthäus Friedrich Beck (1708 bis 1780). Paten waren auch der Hofkaplan Carl Heinrich Rieger, weitere Persönlichkeiten in Württemberg und Verwandte aus den Hartmann- und Burk-Familien.. Die bekanntesten Söhne des Ehepaares Israel Hartmann waren Immanuel Israel Hartmann (1772 bis 1849) und Gottlob David Hartmann (1752 bis 1775), der Professor der Philosophie in Mitau war, der Hauptstadt des damaligen Herzogtums Kurland, und dort leider früh verstarb.
Zu den Aufgaben von Israel Hartmann gehörte der Organistendienst in der Schlosskapelle. Außerdem hielt er jeden Sonntagabend in Ludwigsburg die pietistische Stunde, zu der viele einfache Leute, Bürger und auch adelige Kammerherren, Geheimräte und Generäle und deren Angehörige kamen. Bis zu seinem Lebensende pflegte Israel Hartmann Freundschaften mit bedeutenden Gelehrten seiner Zeit, wie zum Beispiel mit dem berühmten Pfarrer Friedrich Christoph Oetinger (1702 bis 1782), mit dem Pfarrer und Ingenieur Philipp Matthäus Hahn (1739 bis 1790) und Johann Caspar Lavater (1741 bis 1801), der ihn sogar im Beisein von Herzog Carl Eugen von Württemberg und Johann Wolfgang v. Goethe (1749 bis 1832) im Ludwigburger Waisenhaus besuchte.
Israel Hartmann suchte häufig den Dichter Christian Friedrich Daniel Schubart (1739 bis 1791) auf dem Hohenasperg auf, der dort von 1777 bis 1787 eingekerkert war, um Schubart seelischen Beistand zu leisten.
Der Tod seiner geliebten Ehefrau Agnes Rosine am 12. März 1795 schmerzte Israel Hartmann bis zu seinem Lebensende. Ein Neffe seines früheren Förderers Vikar Moser in Plieningen, der Jurist, Politiker und Schriftsteller Friedrich Carl von Moser (1723 bis 1798) verbrachte seinen Lebensabend in Ludwigsburg und wurde ein treuer Freund der Familie und des Witwers Israel Hartmann. Elf Jahre nach seiner Ehefrau starb der überzeugte Pietist am 4. April 1806 im damals sehr hohen Alter von 81 Jahren. Israel Hartmann hat den Pietismus auch den einfachen Bürgern nähergebracht, weshalb ihn Dr. Wolfgang Weisser in seiner Kurzbiografie in der bei den Quellenangaben aufgeführten Broschüre als Leuchte des Pietismus bezeichnet.
Doris Eckle-Heinle
Im Februar 2025
Quellen:
Hartmannsbuch 1898, Seite 10 bis 12
Hartmannbuch 1953, Seite 13, 15, 16, 18
Wolfgang Weisser: Die HARTMANN aus Plieningen, Bedeutende Diener und Beamte des Hauses Württemberg, Broschüre: Hrsg. Familienverband Hartmann e. V., Stuttgart
Wolfgang Weisser und Thomas Held: Die HARTMANN aus Plieningen in Südwestdeutsche Blätter für Familien- und Wappenkunde Bd. 38 – 2020 Seite 207 bis 255
